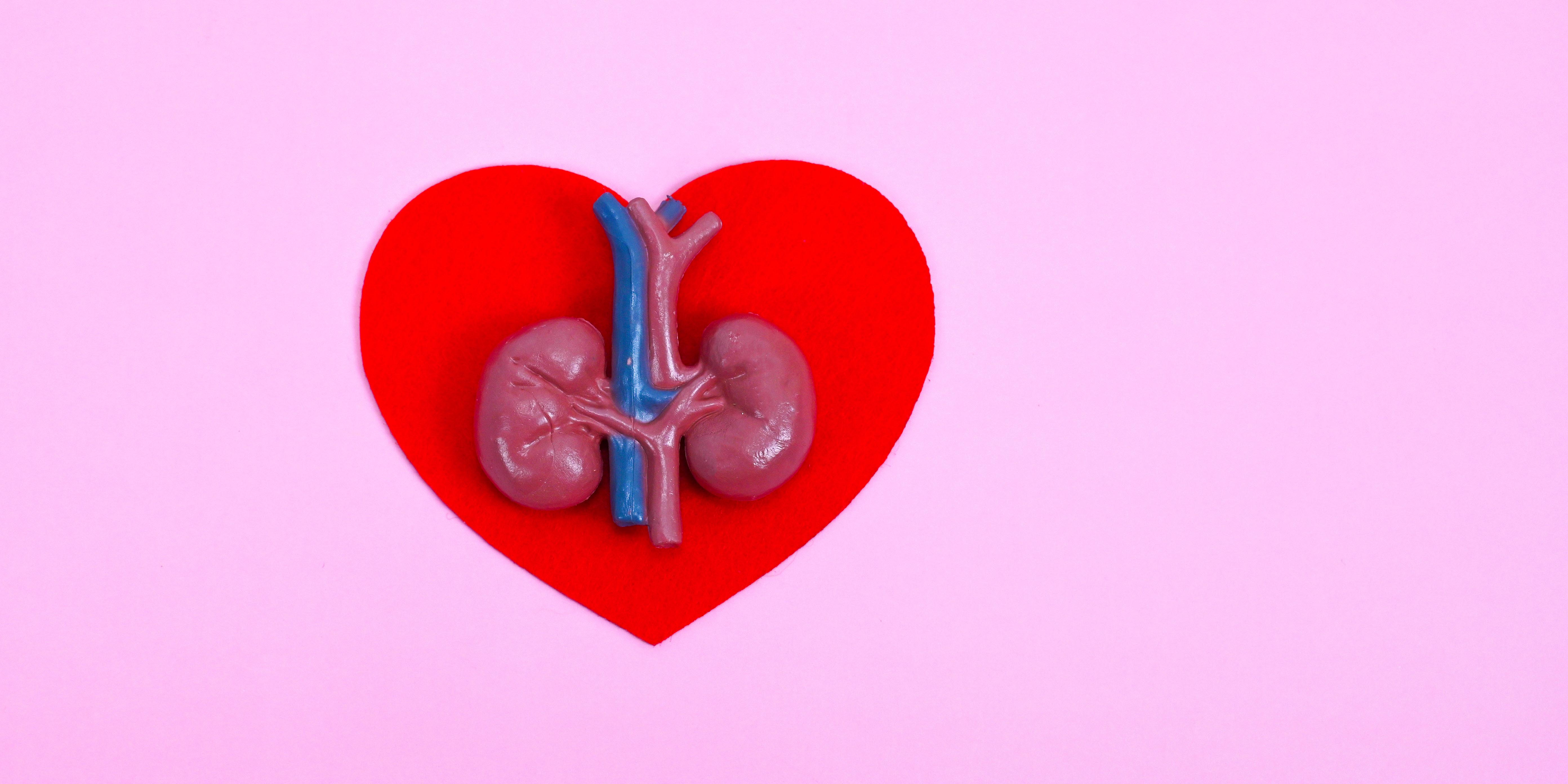Seit Anfang 2020 wütet die Corona-Pandemie auf der ganzen Welt. Neben der Gefahr, die vom Virus an sich ausgeht, leidet auch zunehmend unsere Psyche. Die Folge können unter anderem Depression, Angststörung und Posttraumatische Belastungsstörung sein.
Erfahrungen mit derartigen Erkrankungen hat Professor Dr. Johannes Kruse. Er ist Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie des Universitätsklinikum Gießen und Marburg am Standort Gießen.
Im Gespräch mit dem RHÖN-Gesundheitsblog spricht er über besonders gefährdete Menschen, auf den ersten Blick paradoxe Verhaltensweisen bestimmter Personen – und Möglichkeiten, die eigene Psyche bestmöglich zu schützen.
Herr Professor Kruse, welche Auswirkungen hat die Pandemie auf unsere Psyche?
Sie sind tatsächlich erheblich. Aus zahlreichen Studien weiß die Wissenschaft mittlerweile, dass die Pandemie mit erhöhter Depressivität und Ängstlichkeit einhergeht. Viele Menschen fühlen sich deutlich gestresst, und das vielfach schon über einen langen Zeitraum hinweg.
Nehmen wir Menschen diesen Stress bewusst wahr, oder passiert das alles im Unterbewusstsein?
Wir nehmen ihn durchaus wahr. Auch aus meiner klinischen Arbeit als Psychosomatiker kann ich bestätigen, dass schwerere Verlaufsformen der psychischen Störungen unter den Pandemiebedingungen merklich zugenommen haben.
Wie erklären Sie sich diese Auswirkungen der Pandemie auf unsere Psyche?
Problem ist nicht nur das Virus selbst, sondern die Umstände, die das gesellschaftliche Leben mittlerweile in vielen Teilen bestimmen. Man denke nur an die Bilder aus den Krankenhäusern des italienischen Orts Bergamo als die Särge der Verstorbenen heraus getragen wurden. Diese Bilder sind in das kollektive Gedächtnis unserer Gesellschaft übergegangen. Solche visuellen Eindrücke prägen das Bild, das viele von uns von „Corona“ haben. Das lag auch teilweise an einer Medienberichterstattung, die einen großen Fokus auf den Katastrophenaspekt gelegt hat.
Zu den schwierigen Umständen zählen Sie sicher auch die Kontaktbeschränkungen?
Ganz sicher. Einfach deswegen, weil für unsere psychische Gesundheit soziale Kontakte von großer Bedeutung sind. Das sogenannte – aus infektiologischen Gründen – Social Distancing und die damit einhergehende Einsamkeit, die viele Menschen erleben, sind ein großes Problem geworden. Zudem fallen viele Freizeitaktivitäten weg. All das hat dazu geführt, dass viele sich nicht mehr „eingebunden“ fühlen. Besonders betroffen waren und sind vor allem Alleinerziehende. Dramatisch kann die Situation auch werden, wenn sich ein Mensch darüber hinaus auch noch mit finanziellen Problemen auseinandersetzen muss. Manche sind außerdem in eine Situation geraten, in der sie sich von einem nahen Angehörigen aufgrund der Schutzmaßnahmen nicht gebührend verabschieden konnten. Das schmerzt.
Gibt es grundsätzlich Menschen, die besonders gefährdet sind, unter den aktuellen Bedingungen psychische Probleme zu entwickeln?
Vor allem Patient:innen mit chronischen körperlichen Erkrankungen. Ich weiß zum Beispiel von Menschen, die an Diabetes leiden, dass sie vermehrt Ängste und Depressionen entwickelt haben. Weil sie zu den Risikogruppen zählen, die bei einer Corona-Infektion einen ungünstigeren Verlauf aufweisen. Andererseits muss man erwähnen, dass diese sich in der Regel wesentlich konsequenter als vorher an die entsprechenden medizinischen Vorgaben gehalten haben. Sie haben also mehr auf Bewegung geachtet und ihren Blutzucker häufig besser eingestellt. Aus Angst also haben sie sich besser geschützt. Die andere Gruppe, die besonders gefährdet ist, sind Kinder und Jugendliche. Sie haben seit den Schulschließungen mit teilweise großen psychischen Problemen zu kämpfen. Wir wissen, dass besonders bei pubertierenden Mädchen die Essstörungen deutlich zugenommen haben, und auch die Angststörungen. Feststellen lässt sich gerade bei den Jungen auch eine Zunahme der Spielsucht.
Was kann helfen, wenn man sich in der aktuellen Situation gestresst, ängstlich und niedergeschlagen fühlt?
In diesen aktuellen Phasen der hohen Unsicherheit sind gute, verlässliche Information und eine nachvollziehbar handelnde Politik zentral. Ähnlich wichtig ist das Vertrauen in zwischenmenschliche Beziehungen. Das legt auch ein aktueller OECD-Bericht nahe, der relevante Literatur zum Thema zusammengetragen hat. Dieses Vertrauen ist zentral für unsere Lebensqualität und dem Umgang mit einer gesellschaftlichen Krise.
Ein erwähnenswertes Beispiel dafür ist die erste große Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Beginn der Pandemie. Auffällig war, dass die angekündigten klaren Maßnahmen dafür gesorgt haben, dass bei vielen Menschen das Angstniveau gesunken ist.
Gibt es weitere Hilfsmöglichkeiten?
Um aufkommende Ängste und Niedergeschlagenheit zu bewältigen, ist der erste Schritt, diese bewusst zu spüren und zu benennen. Dann werden sie in aller Regel auch etwas weniger. Und man kann Dinge tun, die entspannen oder beruhigen. Der zweite Schritt ist dann, über die Ängste und Niedergeschlagenheit mit anderen Menschen zu sprechen, sie mitzuteilen – und zu prüfen, ob sie begründet oder unbegründet sind. Auch Bewegung, Sport und Hobbys können helfen, mit den Ängsten und dem Stress besser umzugehen.
Was können Sie und Ihre Kolleg:innen für Menschen tun, die an Depressionen oder einer Angststörung leiden?
Wenn sich regelrechte psychische Störungen entwickeln, dann ist die Psychotherapie oftmals die Methode der ersten Wahl. Bei Depression und Angststörung wird sie durch eine sogenannte Psychopharmako-Therapie ergänzt. Auf der einen Seite gibt es ambulante Behandlungsmöglichkeiten, aber auch tagesklinische und stationäre Angebote. An den verschiedenen Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG haben wir eine ganze Reihe psychosomatischer und psychiatrischer Ambulanzen, an die sich Betroffene wenden können. Hier helfen Expert:innen dabei, ein passendes Therapiekonzept anzubieten. Ansprechpartner Nummer eins ist der Hausarzt, der an die jeweilige Ambulanz überweisen kann. Daneben gibt es auch stationäre Einrichtungen, die besonders bei starken Depressionen, Angststörungen, Essstörungen und Posttraumatischen Belastungsstörungen sinnvoll sind. Gerade dann, wenn eine intensive Psychotherapie helfen kann.
Lassen Sie uns noch auf die Menschen schauen, die die Krankheit Covid-19 durchmachen oder durchgemacht haben: Entwickeln sie psychische Auffälligkeiten?
Diese Patient:innen leiden vermehrt unter Depression und Angststörungen. Und nach intensivmedizinischen Behandlungen oft auch unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), die länger anhalten kann – und behandelt werden sollte. Bei all jenen, die nicht stationär behandelt worden sind, normalisiert sich die Situation in der Regel relativ schnell.
Medial wird immer wieder über das Post-Covid-Syndrom berichtet, also das Leiden nach Überstehen der Covid-Erkrankung. Was sagt die Wissenschaft dazu?
Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und Antriebsarmut werden von Betroffenen immer wieder genannt. Ein Aspekt in der Entstehung dieser „Nach-Erkrankung“ ist tatsächlich auch psychischer Natur: Ein Teil der Patient:innen entwickelt nach Durchmachen der Covid-Erkrankung offenbar große körperbezogene Ängste und Verunsicherung. Und ebendiese Faktoren dürften ein Teil der Problematik des „Post-Covid“-Syndroms sein.
Wie können Menschen einen Weg aus dieser Verunsicherung und Einsamkeit finden?
Wichtig ist zunächst zu wissen: Die Angst, die wir alle, mehr oder weniger, verspüren, ist etwas vollkommen Normales. Sie schützt uns alle davor, zu leichtsinnig zu sein. Ich empfehle jedem, sich solide, aber eben nicht übermäßig zu informieren. Daneben ist es sehr sinnvoll, soziale Kontakte zu pflegen, so gut es aktuell eben geht. Womit wir bei einem positiven Aspekt wären, den die Lockdowns mit sich gebracht haben: Dass Eltern und Kinder sich gegenseitig wieder stärker wahrgenommen haben. Einfach durch das gemeinsame Miteinander zuhause. Dieser Kontakt ist wichtig, gerade für die Entwicklung der Kinder.
Geht es beim Miteinander ums Reden, oder ums Berühren, oder um beides?
Es ist eine Mischung aus vielen Komponenten. Entscheidend ist auch nicht die Anzahl der Kontakte, sondern dass es zumindest einen Menschen gibt, mit dem man offen reden kann. Telefon, Videokonferenz – das alles ist gut. Aber persönliche Treffen sind das Wichtigste!
Ihr Experte für Psychosomatik:
Professor Dr. Johannes Kruse
Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie des Universitätsklinikum Gießen und Marburg am Standort Gießen.